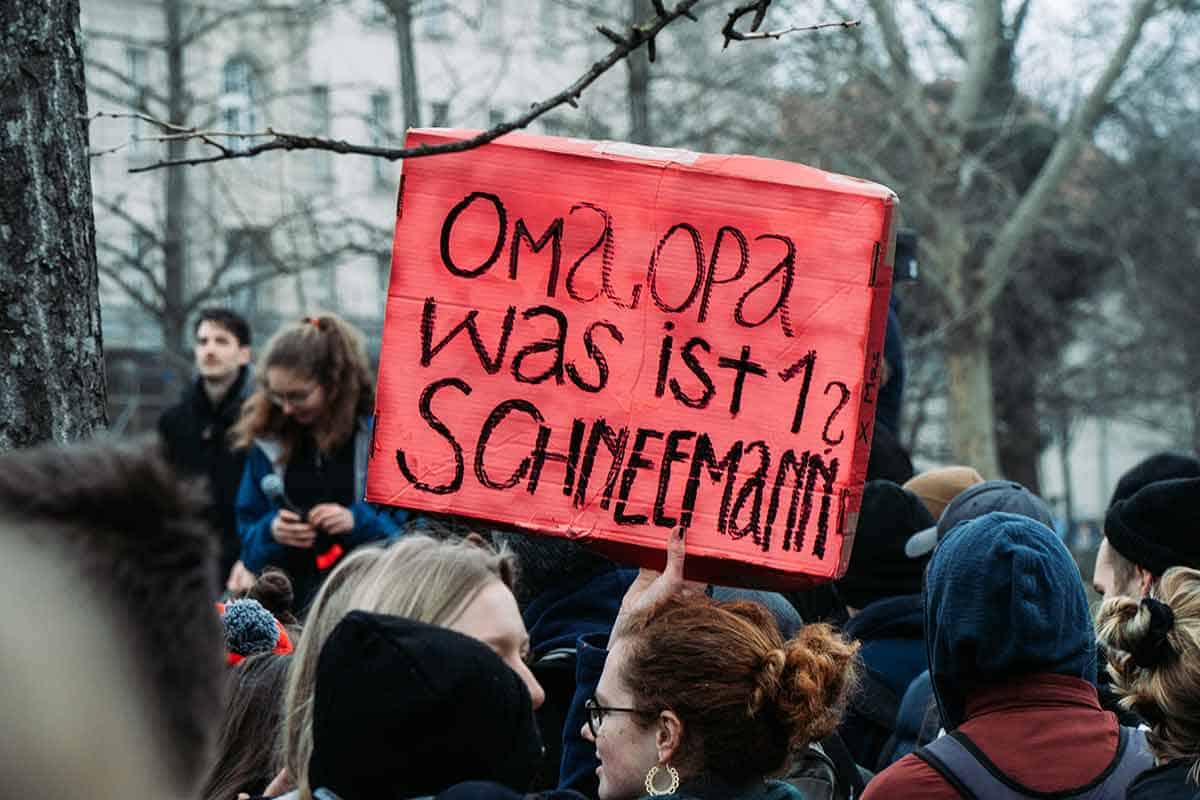Schlafen ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen. Ruhe, Entspannung und Erholung sind für den Organismus genauso wichtig wie Nahrung. Dazu kommt, dass jeder Mensch eigene Vorlieben zur Erfüllung seines Ruhe- und Schlafbedürfnisses hat: Der eine schläft bei Licht, der andere beim TV-Geräusch, der nächste muss lange schlafen, um erholt zu sein, und manche schlafen wie ein Stein.
Diese Vorlieben sowie das Schlafbedürfnis an sich entwickeln sich erst im Laufe des Lebens. Auch für Säuglinge und Kleinkinder ist Schlaf ein wichtiges Grundbedürfnis, verläuft jedoch anders als beim Erwachsenen. Gerade mit Blick auf den Ausbau der Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren gerät der kindliche Schlaf und dessen Begleitung in den Fokus und die Praxis der Elementarpädagogik. Schlaf ist ein sensibles Thema in der Zusammenarbeit mit den Eltern, da Schlaf als geteiltes Betreuungsfeld direkte Auswirkungen auf die familiären Abläufe haben kann.
Beim Schlafen kommen Muskeln und Sinne zur Ruhe und sind nicht einsetzbar. Evolutionär betrachtet, ist der Schlaf die Zeit, in der der Mensch am anfälligsten ist: Denn er ist nicht in der Lage zu fliehen oder sich zu verteidigen. Entsprechend gelingt uns diese Entspannung und das Abschalten aller Sinne nur, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen. Babys und Kleinkinder können für diese Sicherheit noch nicht selbstständig sorgen und aktivieren daher insbesondere das Bindungssystem zur vertrauten Bezugsperson, indem es deren Nähe, Schutz und Körperkontakt sucht (vgl. Renz-Polster 2017). Gleichzeitig braucht es möglichst vertraute und sicher Abläufe. Das bedeutet konkret: eine liebevolle, rituelle und achtsame Begleitung (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 22).
Entwicklung des Schlafbedürfnisses und die Funktionen von Schlaf
Wir alle wissen mittlerweile, dass sich der Schlaf in unterschiedliche Phasen unterteilt. Hier gibt es die Tiefschlafphase, in der der Großteil des Erholungsprozesses stattfindet und Weltwissen verarbeitet und abgespeichert wird. Daneben steht die Traumphase (auch REM-Phase genannt), in der emotionale Erlebnisse gespeichert werden und die die Basis für die Verarbeitung neuer motorischer Fähigkeiten ist. Oft schließt sie sich dem Tiefschlaf an, bevor der Zyklus von Neuem beginnt (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 37). Die Dauer diese Schlafzyklen ist je nach Lebensalter unterschiedlich lang:
| 1. Lebensjahr: |
50-60 Minuten je Zyklus |
| 2. Lebensjahr: |
70-80 Minuten je Zyklus |
| bis 6. Lebensjahr: |
~ 90 Minuten je Zyklus |
Ein Baby erwacht sogar oft nach jedem Wechsel der Schlafphase und muss erst lernen, von allein wieder einzuschlafen (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 28). In ähnlicher Weise ändert sich der Schlafbedarf der Kinder über die ersten Lebensmonate und -jahre hinweg. Der Bedarf ist hierbei auf den gesamten Tag zu rechnen, sodass deutlich ist, dass Tages- und Nachtschlaf in enger Beziehung und Abhängigkeit zueinander stehen.
| Alter |
durchschnittlicher Gesamtschlaf |
Episodenzahl |
| bis zum 2. Lebensmonat |
~ 15 Stunden |
verteilt über den gesamten Tag, keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht |
| 3.-6. Lebensmonat |
~ 13 Stunden |
in 2-4 Schlaf-Episoden |
| 1.-2. Lebensjahr |
~ 12 Stunden |
in 1-2 Schlaf-Episoden |
| 2.-3. Lebensjahr |
12 Stunden |
in 0-1 Schlaf-Episoden |
| 3.-5. Lebensjahr |
11,5 Stunden |
in 0-1 Schlaf-Episoden |
(vgl. Kramer & Gutknecht, 2018, S. 35f)
Oben wurde schon beschrieben, dass der Körper im Schlaf Sinne und Körperbewegungen eingeschränkt. Die Körpertemperatur wird außerdem reduziert, Atmung und Puls wie auch die Stresshormone sinken ab. In den Tiefschlafphasen konnten hohe Werte der Wachstumshormone nachgewiesen werden, was besonders für das Wachstums des Gehirns und des zentralen Nervensystems wichtig ist. Grundlegende hormonelle Veränderungen im Schlaf führen zu wichtigen Aufbauvorgängen im Stoffwechselsystem (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 25f).
Ausreichend Schlaf und Ruhe führen entsprechend zu einer besseren kognitiven Entwicklung und Gedächtnisleistungen. Das bedeutet umgekehrt, dass Schlafmangel und schlechte Schlafqualität zügig Stimmungsschwankungen, Wahrnehmungsprobleme, Unkonzentriertheit und eine Neigung zu Infektionskrankheiten sowie Unfällen nach sich ziehen (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 26).
Müdigkeitsanzeichen und Einschlafstrategien
So wie die Entwicklung eines jeden Kindes unterschiedlich ist, so sind auch die Anzeichen von Müdigkeit und die Strategien zum Einschlafen unterschiedlich. Es gilt daher gerade im Krippen-Bereich, jedes Kind genau zu beobachten und seine Anzeichen und Strategien kennenzulernen. Unabdingbar ist hierzu ein ausführliches Gespräch zu Beginn der Eingewöhnung, das die Rituale und Abläufe zu Hause thematisiert. Auch im Verlaufe der Zeit ist ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern bedeutend, um gute Schlafsituationen für jedes Kind zu schaffen.
Die Kinder müssen eine Strategie zum Einschlafen erst entwickeln. Neben neurobiologischen Prozessen sind auch Temperament und schon gelernte Verhaltensmuster Einflussfaktoren. Die Regulation von Wach- und Ruhezustand ist daher eine elementare Entwicklungsaufgabe der ersten Jahre. Die meisten Kinder in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres haben noch keine Strategie zum selbstständigen Wiedereinschlafen und benötigen entsprechend Hilfe von vertrauten Personen. Erst im 2. und 3. Lebensjahr konstituieren sich zunehmend das Repertoire an selbstgesteuerten Mechanismen zur Regulation von Emotionen und Erregung (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 30).
Die Einschlafstrategien unterschieden sich in selbstgesteuerte und personenbezogene Strategien. Selbstgesteuerte Strategien sind Embryohaltung einnehmen, am Daumen oder Schnuller nuckeln, mit Kuscheltier oder Händen spielen, brabbeln, zu den personenbezogenen zählen Stillen oder Fläschchen geben, Wiegen im Arm, Streicheln, Körperkontakt, Singen, Musik/Geräusche. Besonders in schwierigen Phasen (Fremdel- und Trotz-Phase, schwierige Lebensereignisse) finden beide Strategien Anwendung. Diese sollten genau an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet sein. Gleichzeitig sollte man im Blick behalten, dass das Kind es wieder schafft, sich stärker zu den selbstgesteuerten Einschlafstrategien hin zu entwickeln, alles unter dem Fokus der Ermutigung und Hilfe (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 31f).
Kleinkinder verfügen meist noch nicht ausreichend über die sprachlichen Voraussetzungen, ihre Müdigkeit zu verbalisieren. Sie wählen naturgegeben andere Möglichkeiten wie Gestik, Mimik u. ä. Für Personen außerhalb des Eltern-Kreises sind Einschätzung und Interpretation der Anzeichen zunächst schwierig. Neben den leicht erkennbaren Anzeichen wie Augenreiben oder -zufallen, stierender, glasiger Blick suchen viele Kinder gezielt und vermehrt Körperkontakt zu vertrauten Personen. Oft spielen sie mit eigenen Körperteilen, wie Haaren, Ohren, Kleidungsstücken (oder auch denen der Bezugsperson) oder lehnen den Kopf an. Manche Kinder sind im Zustand der Müdigkeit besonders weinerlich und jammern. Besonders wenn die Müdigkeit schon weit fortgeschritten ist, fangen viele Kinder an, motorisch aufzuspulen, und sind übermäßig aktiv, wobei die Koordination ihrer Bewegungen oft nachlässt. Das Kind ist deutlich weniger konzentriert, reagiert auf Ansprache oder Aufgaben teilweise gar nicht mehr und das Unfallrisiko steigt. Einige Kinder zeigen in Müdigkeitssituationen herausforderndes Verhalten und beißen, schlagen, kratzen oder streunen mehr oder weniger orientierungslos im Raum umher (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 23).
Den Übergang zum Schlaf und zurück begleiten
Gleich vorweg sei gesagt: Babys und Kinder werden nicht verwöhnt, wenn sie in den Schlaf begleitet werden – auch wenn dies in älteren Erziehungsratgebern und Fachbüchern so postuliert wurde. Das Kind ist ein ‚Gemeinschaftsschläfer‘, das jemanden braucht, um für seine Sicherheit zu sorgen. Die Begleitung in den Schlaf ist eine natürliche Erwartung, die gestillt werden will (vgl. Renz-Polster 2017).
Wie bereits dargestellt, ist der Schlaf der Moment des Schutzlosen. Entsprechend braucht das Kind in dieser Situation umso mehr das Gefühl von Schutz und Geborgenheit. Mit Blick auf die eben vorgestellten individuellen Strategien zum Schlafen und Anzeichen für Müdigkeit bedarf es einer individuellen Begleitung. Konkret nennt sich dies eine responsive Schlafbegleitung. Responsiv bedeutet hierbei, dass die Interaktionen und das Verhalten des Erwachsenen gut abgestimmt ist auf die Signale, die das Kind aussendet. Damit verbunden ist eine entsprechend feinfühlige Beobachtung und Deutung dieser Signale. Besonders in der Übergangssituation ist dies bedeutend.
Betrachten wir den Übergang zum Schlafen in der Praxis, kann man außerdem feststellen, dass dieser Übergang meist sehr lang ist. Letztlich wird er schon mit dem Übergang zum Mittagessen (sofern es sich um einen Schlaf zum Mittag handelt) eingeleitet. Schlaf steht auch in enger Verbindung mit dem Sättigungsgefühl. Die Herausforderung besteht darin, Kinder mit unterschiedlichen Stimmungslagen und körperlichen Spannungsvoraussetzungen sowie individuellen Bedürfnissen feinfühlig und responsiv zur Ruhe und Entspannung zu begleiten (vgl. Kramer & Gutnecht 2018, S. 40).
Wichtig ist es, sich zum einen den Ablauf des Übergangsprozesses an sich anzuschauen, zum anderen die Rolle der Fachkraft. Dass die Fachkraft die Signale des Kindes sehen, deuten und darauf abgestimmt reagieren soll, wurde dargelegt. Doch auch die Empfindungen und Stimmungen der Fachkraft spielen beim Übergang eine Rolle. Ist man als Fachkraft selbst gestresst, genervt, gehetzt, wirkt sich dies durch die Vitalfunktionen der Fachkraft direkt auf die Kinder aus: Sie suchen mehr Nähe, brechen aus den Ritualen aus oder finden lange nicht zur Ruhe. Es gilt also, sich selbst wiederholt zu reflektieren und für die eigene passende Stimmungs- und Erregungslage zu sorgen.
Der Übergangsprozess selbst kann an verschiedenen Punkten angeschaut werden: Wie viele Stationen müssen die Kinder bewältigen (je weniger, desto besser)? Wie verläuft der Tagesablaufpunkt zuvor? Welche Rituale gibt es, und passen sie zu den Bedürfnissen der aktuellen Kindergruppe? Gerade mit Blick auf ritualisierte Handlungsabläufe und erkennbare Signale für die Kinder lassen sich folgende Überlegungen anstellen:
Skripte: Dies ist eine methodische Unterstützung zur Bewältigung von Alltagssituationen. Es werden stets die gleichen Gegenstände und Materialien verwendet, die Handlungsabfolgen sind gleich und der Ablauf transparent. Unter dem Fokus Schlafen bieten sich zum Beispiel feste Orte, situationsbezogene Lieder und Sprüche oder akustische Signale (z. B. Klangschale) an. Auch sinnliche Erfahrungen über Licht und Gerüche können mit einbezogen werden (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 42f).
Ankerplätze: Dieser gibt eine bestimmt Wohlfühltätigkeit vor und unterstützt so die Selbstregulation des Kindes beim Warten. Fürs Schlafen-Gehen bieten sich Kuschelsofas, Leseplätze oder ähnliches an, die charakteristisch eingegrenzt und für alle einsehbar sind. Die Situation am Ankerplatz sollte nach Möglichkeit von einer Fachkraft konstant begleitet werden (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 46).
Magische Momente: Ein solcher wird bewusst erzeugt, indem die Fachkraft gezielt etwas an der Situation oder Atmosphäre verändert. Die Veränderung sollte für die Kinder möglichst sinnlich wahrnehmbar sein und führt so zu einem Innehalten und Umstellen zum Ruhemodus. Konkret kann dies ein abgedunkelter Raum, ein besonderer Duft, das Flüstern der Fachkräfte oder das Innehalten vor dem Raum-Wechsel sein (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 49).
Gruppierung: Die Gruppe der Kinder in Verbindung mit dem Ablauf sollte so strukturiert sein, dass möglichst nicht alle zu einer Zeit das Gleiche machen. So reduziert sich das buchstäbliche Chaos, und den Kindern wird deutlich mehr Lernerfahrung und Partizipation ermöglicht (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 44f).
Neben den Prozessen spielt der Schlafraum eine bedeutende Rolle. Dieser sollte durch seine Gestaltung ein Ort der Ruhe, Entspannung, Geborgenheit sein und Sicherheit und Wohlbefinden vermitteln. Einen so gestalteten Raum verbinden die Kinder dann mit beziehungsvoller Fürsorge. Jedes Kind findet dort seinen eigenen, individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmten Schlafplatz vor. Abgrenzungen zwischen den Matratzen oder Schlafplätzen können sinnvoll sein. Auch die Farb- und Lichtgestaltung sollte bewusst gewählt werden. Die Lage des Schlafraums selbst ist bei einem Bau meist vorgegeben. Es sollte darauf geachtet werden, dass dieser Bereich während des Schlafens möglichst ruhig und ungestört ist.Zwischenstationen wie Zähneputzen oder Wickeln sind möglichst zu vermeiden und lassen sich meist gut auf die Zeit vor dem Essen und nach dem Schlafen legen. Ein Besuch im kalten, oft hellen Waschraum zum Händewaschen treibt die Aktivität der Kinder wieder hoch, besonders wenn mit kaltem Wasser gewaschen wird. Hier bietet es sich an, die Kinder nach dem Essen mit einem Lappen gut zu säubern (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 50).
Hat man den Weg in den Schlafraum bewältigt, schlafen die Kinder noch nicht. Hier sei nochmal an die Einschlafstrategien erinnert und daran, dass einige Kinder die feinfühlige und bewusste Begleitung eines Erwachsenen brauchen. Manchen reicht es, wenn eine vertraute Person daneben liegt, andere brauchen den direkten Körperkontakt, eine Begrenzung oder einen Gesang. Gerade letzteres kann auch dazu dienen, den eigenen Erregungszustand zu reduzieren und dem Kind dadurch zu einem entspannten Einschlafen zu verhelfen. Natürlich spielen besonders beim Schlafen die Übergangsbegleiter (Kuscheltier & Co.) eine bedeutende Rolle. Brauchen Kinder den Kontakt zum Körper des Erwachsenen, ist es wichtig, diesen nicht abrupt zu beenden, wenn das Kind schläft, sondern nach und nach zu lösen. Ähnlich auch, wenn die selbstgesteuerte Strategie ohne Körperkontakt unterstützt werden soll. Dies sollte ein Prozess sein, der dem Kind noch die nötige Sicherheit gibt (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 64).
So wie man die Kinder in den Schlaf begleitet, so ist es auch notwendig, sie aus dem Schlaf heraus zu begleiten. Kinder sind auch hier wieder individuell und folgen ihrem eigenen Ablauf und ihren Bedürfnissen. Die Aufwachphase muss entsprechend ebenso responsiv begleitet werden wie die Einschlafphase. Während einige Kinder mit dem Augenaufschlag wieder in der Welt angekommen sind und direkt ins Geschehen starten, benötigen andere Kinder einige Zeit, zu träumen und nach und nach richtig wach zu werden. Gerade dafür sollte es in der Einrichtung einen ruhigen Ort geben, an den sich die Kinder zurückziehen können.
Licht fördert den Aufwach-Prozess, darf jedoch nicht zu plötzlich eingesetzt werden. Einige Kinder sind trotz Benommenheit in der Lage zu reden und können in einfache Gespräche einbezogen werden, zum Beispiel über die folgenden Aktivitäten. Trinken und Essen treibt den Stoffwechsel wieder an und fördert damit das Erwachen. Der Prozess sollte durch eine Fachkraft mit viel Verständnis und Nähe begleitet werden. Dass Kinder in einem solchen Erregungszustand nicht allein gelassen werden, versteht sich von selbst.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Schlafen in der Einrichtung ist für Eltern ein hoch-sensibles Thema. Auf der einen Seite machen sie sich oft große Sorgen um die Einschlafgewohnheiten ihres Kindes und deren Passung mit den Abläufen der Einrichtung. Kinder sind hier doch flexibel und passen sich in der Regel schnell und gut an die Prozesse an, sofern sie gut begleitet sind. Es gelingt ihnen gut, den Schlafort Krippe oder Kita vom Schlafort zu Hause zu unterscheiden, sodass es in den Ritualen nicht zwingend eine Durchmischung gibt (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 97).
Oben wurde erwähnt, dass der Tagesschlaf (also in der Einrichtung) eng mit dem Nachtschlaf in Verbindung steht. Ein schlechter Nachtschlaf des Kindes zu Hause hat in der Regel einen schlechten Schlaf für die Eltern zur Folge. Gerade bei berufstätigen Eltern führt dies zu Erschöpfung, Gereiztheit und Leistungsabfall und kann schwierige Arbeitsumstände nach sich ziehen (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 97).
So kommt es zu Diskussionen rund um die Dauer des Mittagsschlafes bzw. darüber, ob das Kind überhaupt schlafen soll. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Schlafhäufigkeit des Kindes sich ändert bzw. sich der Mittagsschlaf ausschleift. Hier gilt es, mit den Eltern in feinfühliger Absprache zu bleiben. Zum einen sollte es darum gehen, die Signale des Kindes in der Einrichtung darzulegen und gemeinsam zu deuten (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 99ff). Ein müdes Kind sollte auf keinen Fall in der Einrichtung wachgehalten werden, zumal Übermüdung auch durchaus zu höherer Aktivität und unruhigem Nachtschlaf führen kann (vgl. Renz-Polster 2017). Gleichzeitig kann der häusliche Ablauf betrachtet und beraten werden. Darüber hinaus ist der Zustand des Kindes nach dem Aufwachen oder Wecken zu beleuchten. Manche Kinder sind nach dem gezielten Wecken noch sehr lange in der oben dargelegten Aufwachphase und finden für den restlichen Tag nicht mehr zurück ins Geschehen. Anderen bekommt das Wecken gut, und sie nehmen aktiver am Nachmittag teil. In diesem Kontext sollte auch beobachtet werden, wann ein guter Zeitpunkt für ein eventuelles Wecken ist. Hier bietet sich ein Schlafprotokoll an, sofern dies möglich ist. Sollte sich das Kind zum Beispiel leicht wecken lassen, dann ist auch eine passende Aufwachphase gegeben und ein guter Zeitpunkt gefunden (vgl. Kramer & Gutknecht 2018, S. 99ff).
Der Schlaf von Kindern ist eine herausfordernde, aber auch wichtige Situation im Alltag der Einrichtungen. Durch die hohe Bedeutung der Bindung in diesem Setting entstehen aber auch wunderschöne Momente der Verbundenheit und Geborgenheit, die eine fundamentale Basis für den weiteren Tages- und Entwicklungsverlauf bieten. Mit Reflexion und Ausrichtung auf die kindlichen Signale kann der Schlaf gut begleitet werden!
Literatur
Kramer, M. & Gutknecht, D. (22018): Schlafen in der Kinderkrippe. Freiburg: Herder
Renz-Polster, H. (2017): Schlafen in Krippe und Kita. Verfügbar unter: Schlafen in Krippe und Kita | kinder-verstehen.de (zuletzt aufgerufen am 14.05.2021)
Mehr von Anja Burger