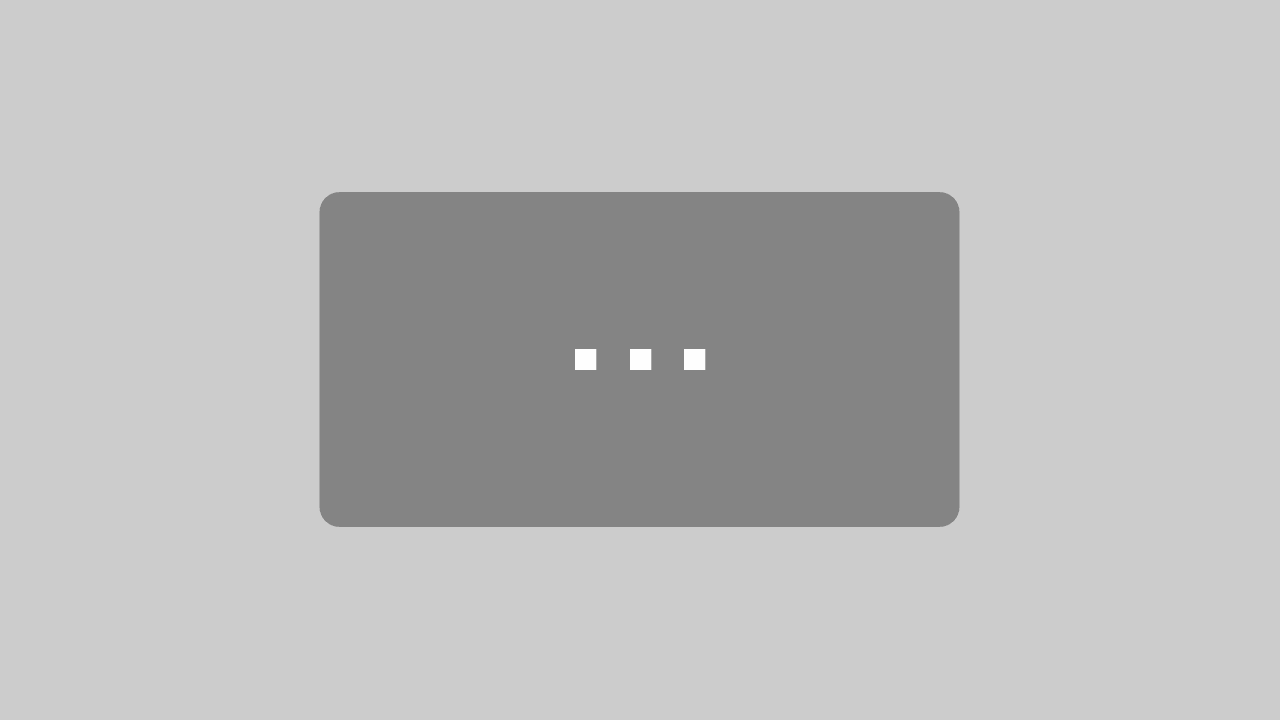Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden und auch in den Kitas läuft noch nicht alles wie gewohnt. Wie ist der reduzierte Regelbetrieb in den element-i Kinderhäusern angelaufen? Welche Herausforderungen sind zu bewältigen? Darüber gibt Carola Kammerlander, Geschäftsführerin Pädagogik bei element-i, einen kurzen Überblick.
Achtsamkeit – Vom Ich zum Wir – Vom Tun zum Sein
Kinder und auch Erwachsene sind heutzutage mit einer Vielzahl an Reizen und Anforderungen konfrontiert. Viele Kinder erleben im Alltag (mitunter durch verschiedene Medien) eine starke Stimulation von akustischen und optischen Sinnesbereichen, wohingegen andere Sinnesbereiche kaum Beachtung finden. Dieses Ungleichgewicht von einerseits Reizüberflutung und andererseits Reizarmut kann zu Problemen in der Wahrnehmung und bei der Verarbeitung von Reizen führen.
Der Begriff der Achtsamkeit ist seit einigen Jahren in aller Munde. Ursprünglich wurde mit Achtsamkeit eine besondere buddhistische Praxis verbunden. Heutzutage hilft diese Haltung in einer gestressten Gesellschaft der „Zuvielisation“ aktiv zu begegnen. Sie unterstützt, bei der Art und Weise sich selbst und anderen zu begegnen und sich auf das Gegenwärtige zu besinnen.
Alle Achtsamkeitsinterventionen beinhalten folgende Aspekte: An erster Stelle ist die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Körper und die gegenwärtigen Sinneseindrücke zu nennen. Das Ziel ist es, die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und zu halten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist eine offene (selbst-)zugewandte, neugierige Haltung geprägt von Akzeptanz. Weiterhin ist die achtsamkeitsbasierte Haltung gekennzeichnet durch das Zurückhalten von Bewertungen und vorschnellen Reaktionen.
Parallelen zur dialogischen Haltung
Eine Haltung von Achtsamkeit beinhaltet nicht nur, das alleinige persönliche Wohlbefinden bzw. die individuelle Situation zu verbessern, sondern sie nimmt auch Bezug auf die Gemeinschaftsbildung. Im Umgang miteinander gilt es kostbare Momente zu erkennen, Routinen zu unterbrechen, sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu widmen und miteinander Momente teilen. Was tun wir alltäglich parallel und rufen den Kindern oder Mitmenschen lapidar bestätigende Wörter zu, anstatt sich diesem Moment voll und ganz zu widmen und in einen „echten“ Dialog zu treten?
Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, Achtsamkeit zu leben und zu praktizieren. Es ist nicht zwangsläufig notwendig, Situationen künstlich zu schaffen. Vielfach ist es ein erster Schritt, Situationen und Wahrnehmungen bewusst zu machen und die Sinne anzuregen, beispielsweise die Augen zu schließen und Geräusche deutlicher und differenzierter zu hören und darauf einzugehen.
Bei den Kindern können wir uns vieles abschauen: Die Gedanken der Kinder richten sich auf die Gegenwart, sie blenden das Gestern und Morgen aus und fokussieren das, was im Moment bedeutsam ist. Kinder können auf natürliche Weise über freies, vertieftes Spielen oder schöpferisches Tätig-Sein ohne Aufwand in einen Zustand des „Bei-sich-seins“ gelangen. Leider gelingt es den Kindern zunehmend weniger, einfach einzutauchen (u.a. aufgrund von sterilen Umgebungen, getakteten Abläufen, reduzierten Naturerfahrungen, wenige nährende Stille). Viele verlernen es, auf ihre Körpersignale zu hören und eine aktive Rolle einzunehmen.
Die Wirkung von Achtsamkeit ist bemerkenswert
Achtsamkeitsbasierte Übungen sind eine gute Möglichkeit, dass Kinder sich und ihren Körper bewusst spüren können. Kinder, die in einem guten Kontakt mit sich selbst stehen, können besser für sich sorgen, Bedürfnisse sowie Gefühle erkennen, benennen und begreifen, dass diese wandelbar und vorübergehend sind. Wer ein gutes Gefühl für sich entwickelt, kann den Wert anderer Lebewesen ermessen und Verantwortung übernehmen.
Eine achtsamkeitsbasierte Haltung sowie Methoden stärken die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstverantwortung und leisten einen nachhaltigen Beitrag zu freudvollem Lernen.
Wichtig ist bei allen Übungen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen. Berücksichtigen sollte man bei Achtsamkeitsübungen mit Kindern stets, dass nicht die Ziele der Erwachsenen („die Kinder sollen runterkommen und ruhiger werden“) verfolgt werden.
Stille und Innehalten ist für viele Kinder nicht auf Abruf möglich. Kinder erleben Stille auch auf ganz andere Weise, in Form von Konzentration bei Tätigkeiten wie Malen, Tiere beobachten, Klangspiel lauschen, etc.. Kinder lieben es, sich selbst zu erforschen und mitzuteilen. Hierzu habe ich eine schöne Übung gefunden: die Taschenlampenrunde! Kinder mögen Taschenlampen, es ist spannend die Taschenlampe ein- und auszuschalten und zu verfolgen, wohin der Lichtstrahl strahlt und wie Licht und Schatten sich bewegen. Die Taschenlampe geht im Kreis herum und wird auf ihrem Weg mit den Worten begleitet „Zeige mir, was du in deinem Körper wahrnimmst!“. Jedes Kind kann auf eine Körperstelle leuchten, wo es gegenwärtig etwas wahrnimmt. Kinder sind oft neugierig, auf welche Körperstelle die anderen Kinder das Licht strahlen lassen und Aussagen wie z.B. „Ich leuchte auf meinen Fuß, weil der mich gerade kitzelt.“ Oder „Ich bemerke die Luft in meiner Nase!“ hören.
Bei dieser Übung werden verschiedene Kompetenzen gefördert: sich untereinander zuzuhören, sich selbst wahrzunehmen sowie sich mitzuteilen. In dieser Runde geht es nicht um gestern und morgen, sondern um das Hier und Jetzt.
Vielleicht ist dieser Artikel für viele wieder eine Gelegenheit, sich über kostbare Momente bewusster zu werden und innezuhalten. Kinder können uns im Alltag immer wieder daran erinnern, denn sie haben die Fähigkeiten, im Spiel ganz natürlich den Moment zu wahren und mit ganzer Aufmerksamkeit zu widmen. Möglicherweise können geplante und zielorientierte Aufgaben kurz ruhen, wenn Kinder uns einladen, in ihrem Sein teilzuhaben.
Literaturempfehlung
Gruber, Jutta; Vogel, Detlev (Hrsg.) (2020): Achtsamkeit. Für Selbstwirksamkeit, Resilienz und Partizipation. Weimar
Elternbefragung: Kinderbetreuung in der Corona-Krise
Familien in ganz Deutschland stehen vor Herausforderungen in Hinblick auf die Kinderbetreuung in der Corona-Krise.
TopKita, die Online-Plattform für Kita-Qualität und Kinder brauchen Kinder, die Initiative zur Wiederöffnung der Kindertagesstätten und Grundschulen haben gemeinsam die Corona-Spezial Elternbefragung ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein aktuelles Meinungsbild der Familien zu erhalten, um somit deren Interessen ideal vertreten zu können. Im weiteren Sinne soll damit auch die allgemeine Qualität in deutschen Kitas weiter optimiert werden. Ganz nach dem Motto: Gute Kita-Qualität für alle Kinder – vor, während und nach Corona.
Die Initiatoren wünschen sich dazu so viele Elternstimmen wie möglich. Die Umfrage besteht aus knapp 50 Fragen und läuft vorerst bis 22.Juni 2020. Im Fokus stehen unter anderem Qualitätskriterien für Kitas, die jeweils vor und während der Corona-Zeit beurteilt werden müssen.
Zur Umfrage: https://www.topkita.de/corona
Bild: TopKita
Wie gelingt Kommunikation in Zeiten der Kohorten?
In unserem KiTa-Alltag hat sich einiges verändert. Wir arbeiten nicht mehr so nah an unseren Kolleg*innen wie vor der Corona-Zeit. Dies stellt uns alle vor Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Wie erleben Sie diese veränderte Teamarbeit? Wie läuft die Kommunikation, wenn Sie sich nicht täglich austauschen können?
Für die Kommunikation in Teams ist es nicht nur entscheidend, welche Sachaussagen mitgeteilt werden; es ist maßgeblich, auf welcher emotionalen Basis sie getroffen werden. Doch wie stellt man sich auf die emotionale Basis jedes Einzelnen im Team ein?
Im Schiffsverkehr wissen wir spätestens seit dem Unglück der Titanic, zu welchen Katastrophen es führen kann, wenn einem die Größe des Eisberges nicht bekannt ist. Das Problem ist, dass man nur einen kleinen Teil – etwa 20% – des Eisberges über Wasser sieht. 80% seiner Größe und Ausmaße sind unter Wasser und daher nicht sichtbar.
Was für uns nicht sichtbar ist, können wir nicht einschätzen. Für unsere Kommunikation im Team bedeutet das: Nur sachliche Inhalte wie Zahlen, Daten, Fakten sind auf der rationalen Ebene für alle gleich. Das macht aber nur 20% unserer Kommunikation aus. Ob Inhalte von allen gleich verstanden, akzeptiert und angenommen werden, wird zu 80% auf der emotionalen Ebene entschieden. Diesen hohen Anteil in der Kommunikation zu ignorieren, würde bedeuten, dass der Hintergrund, auf dem die Kommunikation gestaltet wird, verdrängt wird. Dies wäre analog dazu, dass ein Kapitän eines Schiffes sagen würde, es gäbe keine Eisberge, weil keine zu sehen sind.
Für die Kommunikation bedeutet dies, dass unser Gegenüber auch bei Sachfragen und /-informationen immer zu einem Anteil emotional reagiert. Deshalb ist es wichtig, dies in unserem Kommunikationsverhalten zu berücksichtigen.
Was bedeutet dies für unsere Kommunikation?
Wir sollten lernen, die Emotionen unserer Teammitglieder einzuschätzen und unser Kommunikationsverhalten konstruktiv darauf auszurichten. Es macht keinen Sinn, eine verunsicherte Kolleg*in weiter zu verunsichern, sondern ihr durch mein eigenes Kommunikationsverhalten wieder Sicherheit zu geben.
Das Modell des Eisbergs zeigt uns, welche Vorteile ein erfolgreiches Kommunikationsverhalten hat, wenn emotionale Anteile in der Kommunikation beachtet werden. Ob ich verstanden worden bin – so, wie ich es beabsichtigt habe – kann ich erst durch das Feedback meines Gegenübers erfahren.
„Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht mein Gegenüber gehört habe.“ Paul Watzlawik
Literatur:
Erger, R. (2012): Teamarbeit und Teamentwicklung in sozialen Berufen. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen
Mehr Musik – „Singen macht glücklich!“
„Es ist eigenartig, aber aus neurowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, dass die nutzloseste Leistung, zu der Menschen befähigt sind – und das ist unzweifelhaft das unbekümmerte, absichtslose Singen – den größten Nutzeffekt für die Entwicklung von Kindergehirnen hat.“
Dieses Zitat stammt von Gerald Hüther, einem der bekanntesten Neurobiologen der Gegenwart (zitiert nach Kreusch-Jacob 2018, 32). Dass Musik einen großen Nutzen hat, wird nicht nur von den Neurobiolog*innen belegt, auch andere Wissenschaftler*innen und Musikpädagog*innen beschreiben die Wichtigkeit von Musik im Alltag. Gleichzeitig mehren sich die Aussagen darüber, dass in Familien und anderswo seltener gesungen würde als früher, dass Erzieher*innen seltener Instrumente spielen könnten. In der Ausbildung zur Erzieher*in gebe es so wenige Unterrichtseinheiten zu Musik, dass diese nicht einmal ausreichten, um ein Liedrepertoire für wichtige Feste im Jahreslauf aufzubauen (Zimmer 2019). Darüber hinaus sei bedenkenswert, dass ein einmaliges Modul keinerlei Regelmäßigkeit biete. Regelmäßigkeit jedoch ist beim Singen und bei Musik allgemein überaus sinnvoll. Und schließlich stehen an manchen Orten Statements im Raum, über die sich nachzudenken lohnt: „Hauptsache, es wird gesungen. Wie gesungen wird, das spielt doch keine Rolle.“, „Ich kann nicht singen, deshalb spiele ich den Kindern die richtigen Melodien von einer CD vor.“ Diese beiden Statements würde ich in einem ersten Schritt gern näher beleuchten:
„Hauptsache, es wird gesungen. Wie gesungen wird, das spielt doch keine Rolle.“
Die Sängerin Catherine Veillerobe schließt sich dieser These grundsätzlich an, auch wenn sie diese in Bezug auf die Stimmlage differenziert. Über Pädagog*innen, die Singimpulse an die Kinder herantrügen, könne man sich grundsätzlich freuen. Vornehmlich hebt sie im Interview mit Jasmin Zimmer hervor, dass mit der ästhetisch-musischen Bildung viele Kompetenzen gestärkt würden – soziale, kommunikative, das Empathie-Empfinden. Als Beispiel bezieht sie sich auf Erkenntnisse aus der Sprachentwicklungsforschung, nach denen rhythmisch dargebrachte Impulse Kinder stärker stimulierten als rein sprachliche und so die Sprachentwicklung mitunter besser anregten. Verbunden mit Bewegung und Tanz werde „das Singen zu einer ganzheitlichen Betätigung“, es entstehe ein Flow, der „das Wohlbefinden des Menschen erheblich“ steigere (Veillerobe, in: Zimmer 2019).
Etwas komplexer wird es bei der Betrachtung der Stimmhöhe. Ideal – so die Musikerpädagogin – sei es, wenn sich die Stimmen anglichen: die Stimmhöhe der Erzieherin solle sich möglichst an die der Kinder (hohe Stimmlage) angleichen. „Gesunde, ausgeglichene Kinderstimmen bewegen sich hauptsächlich in dem Kopfstimmbereich. Rein physiologisch, betrachtet man die Resonanzräume aber auch die Körperproportionen – der Kopf ist im Verhältnis zum Körper viel größer als bei uns Erwachsenen –, sind Kinder beim Singen in diesem Kopfstimmbereich natürlicherweise zu Hause“ (Veillerobe, in: Zimmer 2019). Bei uns Erwachsenen kommen je nach Stimmfach mehr Bruststimmanteile (vereinfacht gesagt: tiefere Töne) dazu. Da Kinder von uns als Vorbildern lernen, ist es so wichtig, sie beim Finden ihrer Kopfstimmigkeit zu unterstützen und eine kindgerechte Stimmlage anzubieten. So kann die Stimmentwicklung von Kindern gut unterstützt werden.
Nun scheint es manchem Erwachsenen etwas peinlich zu sein, mit den Kindern in hohen Stimmlagen zu singen oder höher, als man vielleicht sonst singen würde. Aber – so die Überzeugung der Sängerin – es kommt auf die eigene Haltung und das angestrebte Ziel an. Nach Erfahrung der Spezialistin singen Kinder häufiger und lieber mit, wenn das Vorbild eher in hoher Stimmlage singt. Und vielleicht animiert man so auch Kinder zum Mitmachen, die eher selten einen Ton von sich geben. So gesehen, könnte man auch sagen: der Erfolg wird den aktiven Sänger*innen Recht geben. Wer ist nicht schon einmal bei einem Konzert in der Kita, das beim Sommerfest geboten wird, gerührt dagestanden und hat sich einfach gefreut, mit welchem Stolz und welcher Inbrunst die Kinder ihr Können präsentieren. Wen packte es nicht, wenn die Kinder beim täglichen Singkreis engagiert mitklatschen, hüpfen, ein Lied oder Passagen davon mitsingen.
„Ich kann nicht singen, deshalb spiele ich den Kindern die richtigen Melodien von einer CD vor.“
Damit komme ich zum zweiten Statement, das nicht selten zu hören ist. Die einfachste Antwort darauf könnte lauten: Kann ich nicht, gibt´s nicht. Mit den dazu nötigen Organen kann jeder Mensch singen; man muss es ausprobieren und in gewisser Weise üben. Auch andere Fertigkeiten erlernt man durchs Tun und durch vielfache Wiederholung, und so verhält es sich auch beim Singen. Mit etwas Mut und gemeinsam mit einer geübten Kolleg*in wird sich die Freude am Singen einstellen. Auf Perfektion kommt es hier gewiss nicht an, „vielmehr auf die Lust am Tönen, am Ausprobieren.“ Dabei können wir Erwachsenen erleben, „wie unsere eigenes Instrument der Stimme wieder zum Klingen kommt – und welche Wirkungen Singen nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf uns selbst hat“ (Kreusch-Jacob 2018, 35).
Beim Abspielen einer CD fehlt darüber hinaus „der menschliche Aspekt, auch die emotionale Anbindung an das Gegenüber“ (Veillerobe, in: Zimmer 2019). Und diese Anbindung spielt, wie bei vielen Lernprozessen, eine bedeutende Rolle. Das singende Vorbild regt das Kind ungleich stärker an mitzusingen, als es eine CD vermag. Das Auflegen der CD kann einfach sein, aber man könnte entgegen halten: Was wir selbst zu produzieren imstande sind, das sollten wir auch zum Anregen gelungener Bildungsprozesse tun. Verstehen Sie mich bitte im besten Sinne, das Abspielen einer CD soll nicht verteufelt werden: Wenn ansteht, ein bestimmtes Lied – vielleicht aus „Peter und der Wolf“ – vorzuspielen, so steht dem nichts im Wege. In dem hier dargestellten Zusammenhang geht es um das Vorbild, das wir als Pädagog*innen sein können, und um ein Lebensgefühl, das sich mit dem Gesang transportiert. Die Opernsängerin und Musikpädagogin Catherine Veillerobe drückt es so aus. „Ein singender Mensch vermittelt nicht nur den reinen Klang, sondern transportiert auch immer tiefgreifende Gefühle und ganze Lebenswelten, die ihn bestimmen.“ Und daraus folgt für sie ganz einfach: „Singen macht glücklich!“ (Veillerobe, in: Zimmer 2019).
Quellen:
Kreusch-Jacob, Dorothée (2018). Schmetterlinge im Ohr. Singen, Spielen, Tanzen – mit Musik ins Leben. Frühe Kindheit – die ersten sechs Jahre. 21. Jahrgang, Heft 2, 30-39
Zimmer, Jasmin (2019): Glück und Gewinn: das Singen mit Kindern. Ein Interview mit der Opernsängerin und Diplom-Musikpädagogin Catherine Veillrobe. https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/musikalische-bildung-rhythmik/glueck-und-gewinn-das-singen-mit-kindern-ein-interview-mit-der-opernsaengerin-und-diplom-musikpaedagogin-catherine-veillerobe (zuletzt aufgerufen: 27.4.2020)
Was macht Musik mit dem Gehirn?
Musik wirkt sich vielfältig auf unser Leben aus: Wir hören Musik zu unserer Unterhaltung, wählen je nach Stimmungslage fröhliche oder traurige Stücke aus, wir bewegen uns oder tanzen dazu, wir klatschen, schnippen und summen mit, wenn uns ein Musikstück begeistert.
Prägung durch Musik beginnt im Mutterleib
Spätestens seit die Neurowissenschaften genauer auf die Auswirkungen von Musik in den verschiedenen Phasen des Lebens schauen und vielfältige positive Bezüge finden, ist klar: Musik gehört von Anfang an dazu. Bereits im Mutterleib hat das Ungeborene Hörerfahrungen (die Schnecke ist etwa in der Schwangerschaftswoche 22 ausgereift) und erkennt Musikstücke wieder. Das zeigt das Ungeborene mit Strampeln und nach der Geburt mit erhöhter Aufmerksamkeit. Die Informationen aus dem Mutterleib sind wichtig und haben einen praktischen Nutzen nach der Geburt (vgl. Pauli 2009), nämlich Wiedererkennung.
Was wird denn mit Bezug zu Musik erforscht? Und was spielt sich in unseren Gehirnen ab? In zahlreichen Artikeln wird von so genannten Transfereffekten gesprochen, die in nahe und weite Effekte unterschieden werden, oder von kreuzmodalen Einflüssen, die man genauer beleuchtet. Kurz gesagt, erforschen Wissenschaftler*innen, „… inwiefern musikalische Tätigkeiten nicht nur kognitive Fähigkeiten stimulieren, sondern auch zu einer Verbesserung der Fähigkeiten in einer Vielzahl von außermusikalischen Bereichen führen“ (Zhang 2015, S. 5).
Der Bezug von musiknahen Kompetenzen erschließt sich unmittelbar: Wer sich mit Musik befasst, sie hört, fühlt, sich nach ihrem Rhythmus bewegt, vielleicht im Grundschulalter ein Instrument erlernt, hat nachweisbar bessere feinmotorische Kompetenzen. Derjenige erkennt Stücke und Töne schneller und genauer wieder als Menschen, die kaum Bezüge zur Musik erlebt hatten (vgl. Zhang 2016, S. 6). Das leuchtet ein, das bestätigt uns unsere Lebenserfahrung ohne Frage.
Transfereffekte von Musik sind enorm
Zu nahezu allen Entwicklungsbereichen sind Forschungen durchgeführt worden: Musik hat positive Auswirkungen auf die sprachliche Entwicklung, auf die Entwicklung des Wortschatzes und später aufs Leseverständnis. Umgang mit Musik verbessert die Gedächtnisleistung, sogar das räumliche Denken, erhöht die Kreativität in Bezug auf Lösungen. Dass die sozial-emotionale Entwicklung durch aktives Musizieren beeinflusst wird, ist nicht nur eine Hypothese. Nein, auch dieser Bezug ist belegt. Vierjährige Kinder sind nach gemeinsamem Musizieren hilfsbereiter und kooperativer. In einer Studie wird der Schluss gezogen, dass durch das gemeinsame musikalische Erlebnis wie Singen intrinsische Wünsche, Emotionen und Erfahrungen in einer Gruppe teilen zu wollen, aufrechterhalten werden (Zhang 2015, S. 13f. bezieht sich auf eine Studie von Kirschner und Tomasello). Das sind wunderbare Nachrichten.
Aber Vorsicht: Musik ist kein Allheilmittel. Viel hilft nicht immer viel. Hat beispielsweise ein Kind eine diagnostizierte Sprachentwicklungsstörung, so ist der Einsatz von Rhythmus und Liedern selektiv einzusetzen. Andere Hilfssysteme und Professionen wie Logopäd*innen, Sprachheiltherapeut*innen etc. sind einzuschalten. Naheliegend ist ebenso, dass die musikalischen Angebote zum Alter der Kinder passen sollten (vgl. Hofmann 2019, S. 2 und 4).
Die Wirkung von Musik im Gehirn
In den ersten 15 Lebensmonaten explodiert die Anzahl der Synapsen in den Gehirnen der sehr jungen Kinder; gleichzeitig werden zwischen den Hirnhälften Verbindungen geschaffen. Unser Gehirn bzw. die Synapsen werden einerseits ausgebaut, andererseits findet eine Art Selektion statt: die Wege, die häufig beansprucht werden, verstetigen sich. Wege, die selten genutzt werden, verkümmern. Ein Beispiel dazu: Bieten wir Kindern Aktivitäten wie Bewegen zur Musik an, werden unterschiedliche Hirnareale gleichzeitig aktiviert. Erlebt ein Kind mehrfach die Stimulation verschiedener Hirnareale durch ganzheitliche Angebote, bilden sich hier entsprechende Gedächtnisspuren. Bei vergleichbaren Aufgaben aktiviert unser Gehirn diese Wege wieder; die vormals angesprochenen verschiedenen Hirnareale werden zur Bewältigung der Aufgabe genutzt. Wir gelangen so gewissermaßen leichter zu einer Lösung. Und jetzt kommt es noch besser: Auch bei neuen und unbekannten Aufgaben, die sich uns stellen, nutzt unser Gehirn diese verstetigten Wege. Weil es sich als nützlich herausgestellt hat, aktiviert das Gehirn gleichzeitig mehrere Areale und verwendet beide Hirnhälften zur Verarbeitung von Sinneseindrücken. Und das kann zu besseren Lösungen in den genannten Entwicklungsbereichen führen (vgl. Hirler 2018, S. 6). Wie praktisch ist das denn?
Auch wenn noch nicht abschließend geklärt ist, ob es sich um mehr oder weniger starke Korrelationen handelt oder ob kausale Zusammenhänge angenommen werden dürfen: In unseren element-i Kinderhäusern können wir musikalische Erfahrungen ermöglichen: ganzheitlich und bildungsbereichsübergreifend, vielfältig an unterschiedlichen Stationen des Tagesablaufs, für ein Miteinander, das Verbundenheit in der Gruppe fördert. Um das Bild von Gerald Hüther zu bemühen: Geben Sie den Kindern mit Musik, Tanz, Bewegung und Rhythmik das Kraftfutter, das ihre Gehirne zur Entfaltung brauchen.
Literatur:
Hirler, Sabine (2018):Rhythmik – Musik, Spiel und Tanz. Frühe Kindheit – die ersten sechs Jahre. Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V. Heft 2, 21. Jahrgang, Berlin, S. 6-15
Hofmann, Bianca (2019): Sprache und Musik. Sprachförderung in der Kita – alltagsintegriert, ganzheitlich, praxisorientiert. Spezialausgabe Dezember 2019
Hüther, Gerald (2014: Singen ist „Kraftfutter“ für Kindergehirne. In: Merkle, Julian; Schmaus, Geli (Hrsg.): Töne im Ohr. Zuhören und Musizieren in Kindergarten und Grundschule. Stiftung Zuhören: München. S. 70-71
Pauli, Marko (2009): Was Föten im Mutterleib hören. Abrufbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/was-foeten-im-mutterleib-hoeren.1067.de.html?dram:article_id=175551 (zuletzt aufgerufen am 21.5.2020)
Zhang, Jinfan (2015): Transfer musikalischer Aktivität auf kognitive Prozesse und experimentelle Studie zur Wirkung der sozialen Umgebung auf die emotionale Wirkung von Musik. Dissertation an der LMU München. Abrufbar unter: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/18780/1/Zhang_Jinfan.pdf (zuletzt aufgerufen am 21.5.2020)
Die Entwicklung eines emotionalen Verständnisses
Im Artikel Kleinkinder: Wie zeigen sie Emotionen und welche? wurde die Grundemotionen bei Säuglingen und Kleinkindern umrissen. Wie angekündigt, soll heute der Blick darauf geworfen werden, wie sich das emotionale Verständnis bei (Klein-)Kindern entwickelt. Dies ist ein Prozess, der selbstverständlich die Kita-Zeit überdauert und nicht nur den frühpädagogischen Bereich betrifft. Daher ist der Abriss der emotionalen Entwicklung zumindest auf den Zeitraum des Kita-Besuchs erweitert – also ein Beitrag nicht nur für Kleinkindpädagogen.
Die emotionale Ausdrucksform von Kleinkindern ist stark mit der Fähigkeit Hinweisreize und emotionale Äußerungen anderer zu erkennen und zu verstehen, verknüpft. Säuglinge können sich auf den Gefühlzustand der Bindungsperson einstellen – durch den vis-a-vis-Kontakt. Sie reagieren entsprechend schon sehr früh angemessen auf den Ausdruck des Gegenübers: Mit 3 – 4 Monaten ist das Baby bereits empfänglich für Struktur und Rhythmus der direkten Interaktion mit den Bezugspersonen. So wartet es auf positive Reaktionen der Bezugsperson und reagiert entsprechend stimmlich oder emotional darauf. Das Spektrum der möglichen emotionalen Reaktionen wird dem Säugling nun immer bewusster. Mit fünf Monaten werden Gesichtsausdrücke als organisierte Muster wahrgenommen und die emotionale Qualität einer Stimme dem passenden Gesichtsausdruck zugeordnet. Sie können also in dieser Zeit bestimmte emotionale Ausdrücke anhand der Grundemotionen unterscheiden. Mit sieben Monaten beginnt das Kind Emotionsausdrücken von anderen Personen eine Bedeutung zuzuschreiben: Die zunehmende Reaktion auf emotionale Gesichtsausdrücke als organisiertes Ganzes zeigt, dass diese Signale für den Säugling einen Sinn bekommen. Es erkennt außerdem, dass emotionale Äußerungen nicht nur eine Bedeutung haben, sondern auch aussagekräftige Reaktionen auf bestimmte Objekte und Ereignisse sind. Eine erste soziale Bezugnahme beginnt mit 8 – 10 Lebensmonaten bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Das Baby sucht in gewissen Situationen nun aktiv nach emotional bewertbaren Informationen des vertrauten Gegenübers. Die emotionale Reaktion der Bezugsperson ist dabei Gradmesser für das Befinden des Kindes, zum Beispiel bei der Reaktion auf Fremde. Indem das Kind beginnt, eine Beziehung zwischen Emotionen und Emotionsanlass zu erkennen, entsteht eine erste leichte Regulation des Verhaltens. Diese soziale Bezugnahme, oder auch soziales Referieren genannt, kann und soll von Eltern genutzt werden, um dem Kind zu vermitteln, wie es auf alltäglich vorkommende Ereignisse reagieren kann und soll.
Um an dieser Stelle einen Querverweis zum Thema Eingewöhnung zu ziehen: Entsprechend ist die Einstellung der Eltern zum Kita-Besuch des Kindes maßgeblich für das Verhalten des Kindes in der Eingewöhnung und in der Einrichtung. Dabei ist die Stimme allein oder in Verbindung mit dem Gesichtsausdruck wirkungsvoller als ausschließlich der Gesichtsausdruck: Die Stimme vermittelt emotionale und verbale Informationen, das Kind muss die Bezugsperson nicht ansehen, sondern kann sich auf das neuartige Ereignis konzentrieren. Das soziale Referieren nimmt im zweiten Lebensjahr bedeutende Zeit im Rahmen der Weltentdeckung ein. Zur Hälfte des zweiten Jahres lernt das Kind eigene emotionale Reaktionen voneinander zu unterscheiden. Es kann nun durch die soziale Bezugnahme die eigene Einschätzung von Ereignissen mit der anderen Personen vergleichen und ggf. anpassen. Soziale Bezugnahme hilft Kindern also, über einfache Reaktion auf emotionale Botschaften anderer Menschen zu reagieren, und trägt so zum zunehmend besseren Verständnis von Emotionen bei. Zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr macht das Kind weitere Fortschritte in emotionalen Fähigkeiten hin zu einer emotionalen Kompetenz: Es erweitert sein emotionales Verständnis, beginnt über Gefühle zu sprechen und reagiert zunehmend angemessener auf emotionale Signale anderer. Dies führt zu einer besseren emotionalen Selbstkontrolle, ersten selbstbezogenen Emotionen und über die Empathie zu einem beginnenden Moralverständnis. Diese emotionale Kompetenz ist entscheidend für Beziehungen zu Gleichaltrigen.
Mit ca. drei Jahren kennt das Kind die Ursachen und Folgen von Emotionen. Ein Jahr später kann es die Ursachen der Grundemotionen besser einschätzen, betont aber noch eher äußere als innere Faktoren. Mit dem beginnenden Vorschulalter versteht das Kita-Kind, dass Wünsche und Annahmen das Verhalten anderer motivieren und versteht, wie innere Faktoren Emotionen auslösen können. Es kann zunehmend eine Handlung auf Grund eines Gefühls voraussagen, erkennt, dass Denken und Fühlen zusammenhängen, und entwickelt wirksame Methoden, um negative Gefühle anderer zu bekämpfen. Da sich das Kind oft noch an den offensichtlichen Hinweisen in einer Situation konzentriert und andere relevante Informationen immer wieder vernachlässigt, treten an dieser Stelle Schwierigkeiten auf, wenn eine Person widersprüchliche Hinweisreize sendet. Dies gelingt zunehmend besser, umso mehr die Eltern oder auch andere bedeutende Kontaktpersonen über Emotionen sprechen und darauf eingehen. Auch hier korreliert die Bindungssicherheit wieder mit dem vermehrten Erklären von Gefühlen und damit mit einem besseren Verständnis von Emotionen. Eine fruchtbares Vehikel zur Entwicklung eines emotionalen Verständnisses sind über die gesamte Kita-Zeit hinweg die Als-ob-Spiele.
Sie haben nun die Gelegenheit in die Reflexion und Beobachtung Ihrer Kinder zu gehen. Welche Emotionen zeigen sie denn schon? An welchen Stellen lässt sich ein erstes soziales Referieren erkennen? Wie ist Ihre eigene Rolle und Bedeutung für die betreuten Kinder hierbei? Und nicht zuletzt: Welche neuen Emotionen haben die Kinder in der Zeit der Corona-Schließung kennen gelernt und sind sie in der Lage zu zeigen?
Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Anregungen zu diesem Thema.
Literatur
Berk, L. E. (2005): Entwicklungspsychologie. 3. Auflage. München: Pearson. Kap. 6.2; 8.3; 10.3.
Siegler, R. S.; DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2005): Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. München; Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag. Kap. 10.
Wenn kleine Kinder beißen
In jeder Krippe und auch in der Kita gibt es von Zeit zu Zeit Kinder, die andere Kinder aus unterschiedlichsten Gründen beißen. Die Thematik ist für Fachkräfte häufig pädagogisch herausfordernd. Besonders kritisch wird es, wenn es Kinder gibt, die wiederholt beißen. Die Gründe der Kinder sind vielfältig, es bedarf einer sehr genauen Analyse der Situation und stets responsiver und achtsamer Reaktionen von Fachkräften.
Das Stigma von Kindern, die beißen
Beißen gilt in unserer Gesellschaft, obwohl es als Verhalten aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht unüblich ist, als besonders grausam im Vergleich zu zum Beispiel Hauen. Das Beißen soll schnellstmöglich abgestellt werden. Kinder, die beißen, werden nicht selten ausgeschlossen und haben einen besonderen Ruf, den sie nicht mehr leicht ablegen können. Dazu möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel aus meinen eigenen Erinnerungen beschreiben. Ich kann mich gut erinnern, welches Kind in meiner Spielgruppe das „Beiß-Kind“ war und auch, wie wir Kinder uns von diesem Kind ferngehalten haben. Das taten wir ohne Rücksicht diesem Kind gegenüber. Wir haben uns versteckt, das Kind beschimpft und uns gegen dieses Kind zusammengetan und abgesprochen, wie wir das Spiel mit ihm vermeiden. Einfach grausam von uns. Ebenso berichtet meine Mutter heut noch, wenn es um das Thema Beißen geht, wie schlimm meine Schwester von diesem Kind gebissen wurde. Geschichten darüber, wer von uns von einem anderen Kind gehauen oder gekratzt wurde, gibt es hingegen nicht. Fragen Sie in Ihrem Umfeld einmal Personen, was Sie über das Beißen und beißende Kinder denken.
Diese Beiß-Situationen können Ihnen begegnen
Die Tragweite und Folgen für ein Kind, das beißt, sind entsprechend schwerwiegend. Ihnen als Fachkraft obliegt aus diesem Grund eine besondere Verantwortung im Umgang mit dem Thema Beißen. In Ihrem pädagogischen Alltag werden Ihnen Situationen wie die Folgenden begegnen:
- Vertieft spielen alle Kinder im Freispiel. Ein Schrei ist zu hören. Sie drehen sich um und sehen, dass Jan in den Arm von Tim beißt.
- Wütend kommt die Mutter von Anna auf mich zu. Anna sei nun schon wieder gebissen worden. Sie sieht den Abdruck auf der Haut ihres Kindes. Sie möchte unbedingt wissen, welches Kind ihre Tochter immer wieder beißt. Sie möchte das Thema privat mit der Mutter klären. Außerdem äußert sie, dass sie, wenn ihre Tochter weiter gebissen würde, sie aus der Kita nimmt. Sie als Fachkraft scheinen die Sicherheit des Kinders nicht gewährleisten zu können.
- Paula und Mathilda streiten sich in der Bauecke. Mathilda wirft absichtlich Paulas Turm um. Sie sehen, wie Paula wütend wird. Sie kennen Paula. Sie hat in letzter Zeit immer wieder gebissen, wenn sie sich mit Kindern gestritten hat.
- Meine Kollegin Sabine kommt zu mir und spricht mich auf ein Kind an, dass in letzter Zeit häufiger gebissen hat. „Wir machen hier in der Kita doch alles richtig. Wir haben uns alle Situationen im Alltag angeschaut. Der Grund, warum Tim beißt, kann nicht in der Kita liegen. Die Eltern kümmern sich nicht genug um ihn. Auf meine Gesprächsanfragen reagieren sie auch nicht.“
- „Ich bin ein Löwe“, ruft Paco und rennt freudestrahlend auf mich zu. Ein Schmerz und verblüfft stelle ich fest, dass Paco seine Löwenzähne in meine rechte Schuler gehauen hat.
- „Vielleicht sollte man das Kind, das beißt, einfach zurück beißen. So merkt es, wie schmerzhaft es ist und dann hört es damit auf“, überlegt ein Kollege in der Teamsitzung.
- „Kinder, die beißen, haben in einer Krippe nichts verloren“, fordert der Elternbeirat in einem Gespräch mit Ihnen.
- „Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin am Ende,“ äußert Paulas Mutter im Gespräch. „Ich mache mir wirklich Sorgen um ihre Zukunft. Ich verstehe nicht, warum sie beißt.“
Nützliche Fragen für Sie als Fachkraft
Als Fachkraft sollten Sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen. Auch im Team sollten Sie sich über Ihre Reaktion und Haltung zum Thema austauschen. Folgende Fragen können Ihnen helfen, weiter über das Thema nachzudenken:
- Wie würden Sie als Fachkraft in einer dieser geschilderten Situationen spontan reagieren?
- Welchem Kind wenden Sie sich nach einem Beiß-Vorfall zuerst zu und wie tun Sie das?
- Stellen Sie sich eine der Situationen vor. Wie fühlen Sie sich: kompetent oder überfordert?
- Welche Ursachen kann Beißen haben?
- Welche Strategien haben Sie, um die Ursachen des Kindes für das „Beißen“ herauszufinden?
- Wie denken Sie über Kinder, die beißen?
- Wie besprechen Sie mit den Eltern die Thematik?
- Welche Eltern sprechen Sie überhaupt an?
- In welchem Setting sprechen Sie mit Eltern?
Über Ihre Gedanken und Kommentare zum Thema freue ich mich.
Literaturempfehlung: Gutknecht, D. (2015): Wenn kleine Kinder beißen. Achtsame und konkrete Handlungsmöglichkeiten. Freiburg: Herder.
Taktile Wahrnehmung – Druck und Schmerz?
Die Haut ist das größte sensorische Organ des Körpers. Sie ist die Verbindung zwischen innen und außen und regelt als Kontaktorgan das Verhältnis zwischen dem Körpergeschehen und der Umwelt. Die Haut hat viele Funktionen und ist für das Überleben des Menschen wichtig. Sie übernimmt unter anderem folgende wichtige physiologische Funktionen:
- Schutzfunktion: Reaktionen auf mechanische Verletzungen, Strahlen, Eindringen fremder Substanzen, etc.
- Temperaturregulation: Reaktionen auf Kälte und Wärme
- Stoffwechsel: Abgabe von Stoffen wie z. B. Schweiß
Die Haut verfügt über eine große Zahl an sensorischen Wahrnehmungsrezeptoren, die verschiedene Reize empfangen: Temperatur, Berührung, Schmerz, Vibration, Druck, Zug, etc. Empfindliche Nervenzellen sitzen dicht unter der Hautoberfläche. Bei bereits leichtem Druck (z. B. Berührung) erzeugen diese ein elektrisches Signal, das über die Nervenbahnen zum Gehirn geleitet wird. Im Gehirn entsteht ein Bewusstsein für die Berührung, und es erkennt die Stärke der Berührung und den Ort der Berührung am Körper. Stärkere Berührung empfinden wir als Druck, einen sehr starken Druck empfinden wir als Schmerz.
Die vier Wahrnehmungsbereiche
Die taktile Wahrnehmung gliedert sich in vier Wahrnehmungsbereiche: Berührungswahrnehmung, Erkundungswahrnehmung, Temperaturwahrnehmung und Schmerzwahrnehmung. Blicken wir nun auf die Schmerzwahrnehmung: Schmerz ist das wichtigste Warnsignal. Die Haut nimmt giftige, schädliche oder verletzende Einwirkungen durch Schmerzen wahr und reagiert darauf. Ein sanftes Schmerzempfinden wird als Warnzeichen wahrgenommen. Ein stechender oder brennender Schmerz ist ein Hinweis auf eine drohende Verletzung und dient der Steuerung weiterer motorischer Aktivitäten. Ohne diese Warnsignale hätten wir bereits viele ernsthafte Verletzungen, Verbrennungen oder Knochenbrüche, ohne sie zu erkennen.
Kinder lernen aus der Erfahrung
Kinder brauchen unmittelbare Erfahrungen, um Situationen einschätzen zu können. Sie müssen tasten und ausprobieren können, um zu erfahren, ob ein Gegenstand sie verletzen könnte oder nicht. Leichte Schmerzempfindungen, die die Haut an das Gehirn weiter leitet, sind Teil des Warnsystems und erregen Aufmerksamkeit. Diese Erfahrungen sind wesentliche Lernerfahrungen. Berührungen unterschiedlicher Intensität sind Reizinformationen, die Dinge und Ereignisse in der Umwelt bewerten (im Hinblick auf Gefahren). Um diese sensiblen Fähigkeiten zu erlangen, benötigen Kinder Erfahrungen wie Berührungen zu lokalisieren, deren Intensität abzuschätzen und auch die Kraft ihrer Extremitäten zu dosieren.
Zur Förderung der taktilen Wahrnehmung sind folgende Aspekte bedeutsam:
- Temperatur: Wie fühlen sich verschiedene Temperaturen an? Was ist kalt und was ist warm? (Achtung: nicht eiskalt bis heiß)
- Berührungsstärke: Was drückt stark? Wie fühlt sich leichter Druck an?
- Berührungslokalisation: Wo habe ich einen Druck gespürt?
- Berührungsqualität: Was habe ich gespürt – spitz, stumpf, glatt, rau, …?
- Druckstärke: Wie stark muss ich drücken, um eine Wäscheklammer zu fixieren, mit einem Stift zu schreiben, eine Zitrone auszupressen …?
- Bewegungsausprägung: Wie stark muss ich anspannen, um einen Ball zu schießen, einen schweren Gegenstand hochzuheben?
- Körperschema: Mit geschlossenen Augen spüren, welcher Finger z. B. wurde berührt?
Quellen:
Zimmer, Renate (2019): Handbuch Sinneswahrnehmung. Freiburg: Herder
Groschwald, Anne; Rosenkötter, Henning (2016): Vom Wahrnehmen zum Lernen. Frühe Bildung in Krippe und Kita. Freiburg: Herder
element-i Vodcast #1: Carola Kammerlander
Zur Premiere unseres neuen element-i Vodcasts macht Carola Kammerlander, Pädagogische Geschäftsführerin bei element-i, den Anfang. In ihrem Beitrag lässt sie die vergangenen Monate Revue passieren, erläutert die Haltung unseres Unternehmens und schaut in die Zukunft.